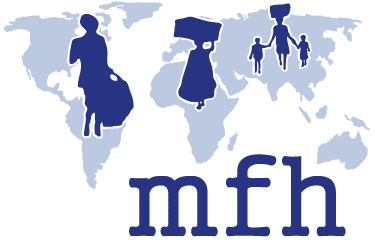Anforderungen
an die Traumatherapie
Zum Bedarf für ein Therapiezentrum
für Folteropfer in Bochum
von Knut Rauchfuss
Im öffentlichen Diskurs, wie auch in Veröffentlichungen von
Landes- und Bundesbehörden ist ein zunehmend inflationärer Umgang
mit dem Wort „Trauma“ zu verzeichnen. Auch fachmedizinisch wird
gelegentlich offensiv vertreten, es bestehe kein Unterschied in der Behandlung
posttraumatischer Belastungsstörungen (PTSD), der mit der Ursache
des Traumas (Unfall, Krieg etc.) in Zusammenhang stehe; die Therapie sei
im Wesentlichen identisch und könne daher von den herkömmlichen
therapeutischen Einrichtungen in hinreichendem Maße abgedeckt werden.
– Das Gegenteil ist jedoch der Fall.
Der inflationäre Gebrauch des Traumabegriffs verwischt die Grenzen
zwischen extremer Traumatisierung und Alltagskonflikten, wenn Unfall,
„Mobbing und Arbeitslosigkeit neben den Holocaust und die Vergewaltigung
gestellt werden“. (Küchenhoff 2000) Derart werden traumatische
Erfahrungen banalisiert, erhalten banale Konflikte den Stellenwert eines
Traumas. Von einer solchen Gleichsetzung distanzieren sich Fachkreise,
die über Erfahrungen im Umgang mit Opfern staatlicher Gewalt verfügen,
in zunehmendem Maße.
Die nivellierenden Folgen der Diagnosekategorie PTSD
In gewisser Weise leistete
die Einordnung des posttraumatischen Stresses, bzw. der posttraumatischen
Belastungsstörung (PTSD), in die Diagnosekategorie „Angststörungen“
im „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM
IV) durch die American Psychiatric Association dieser Gleichsetzung Vorschub,
denn während die Liste der Symptome lang und ausführlich ist,
fallen die Bezüge auf das traumatische Ereignis äußerst
vage aus. Auch die Reaktionen des Subjekts werden ausschließlich
an einer unvollständigen Reihe von Symptomen festgemacht.
Wie David Becker 1997 ausführt, ist „diese mangelnde Differenzierung
nicht nur falsch, sondern in Bezug auf verschiedene Aspekte sogar gefährlich.“
Becker wendet ein, dass die gleichmacherische Definition des Stresses
die Täterschaft verleugne, sie konzeptionell zum Verschwinden bringe
und damit ein Verständnis des Verhältnisses zwischen der Symptomatik
und dem gesellschaftlichen Zusammenhang verhindere. Dies habe zur Folge,
dass das Augenmerk sich nur noch auf die individuelle Pathologisierung
der Opfer richte und damit Heilungschancen, z.B. durch Anklage und Verurteilung
der Täter, außer Acht lasse. Rückfälle bei erneuter
Konfrontation mit der Unterdrückungssituation seien die Folge. Auch
könnten mit PTSD die langfristigen Folgen einer Traumatisierung nicht
erfasst werden. „Im Rahmen des PTSD ist das Trauma ein einmaliges
Ereignis, das entsprechende Folgen nach sich zieht. Ein Verständnis
der Akkumulation und der Prozesshaftigkeit einer traumatischen Erfahrung
sowie des Wechselverhältnisses zwischen gesellschaftlichen Ursachen
und individueller Reaktion wird nicht möglich.“ (Becker 1997)
Gleichermaßen kritisieren auch andere AutorInnen das eindimensionale
Konzept des PTSD mit ähnlichen Argumenten (Summerfield 1997, Seibert
2000, Merk 2000).
Doch auch als Diagnose im medizinischen Sinne, als Begriff zur Kategorisierung
der bei traumatisierten KlientInnen auftretenden Symptome, leistet PTSD
nicht, was es leisten sollte. Zu ungenau und unzureichend in seiner Definition,
erweist es sich nicht als Hilfestellung, Beobachtungen zu ordnen und eine
Diagnose zu stellen. Im Gegenteil, bisweilen erscheint PTSD wie eine erfundene
„Krankheit“, die manchmal nach diesem Muster verläuft,
aber manchmal auch völlig anders. Die Symptome, die PTSD anführt,
sind eben nicht die einzigen, die jenen, die mit traumatisierten Menschen
arbeiten, begegnen. Auch die Medizinische Flüchtlingshilfe ist immer
wieder mit der gesamten Bandbreite psychischer, somatischer und psychosomatischer
Krankheitsbilder konfrontiert, ebenso wie mit Problemen im sozialen Umfeld
der Betroffenen.
Zwischen den jeweiligen Ursachen eines Traumas und Ausmaß und Art
der resultierenden Störungen bestehen – vermittelt über die
individuelle Konstitution des Opfers und seines bzw. ihres sozialen Umfeldes
– erhebliche Unterschiede. Diese Unterschiede muss eine angemessene Therapie
anerkennen, aufgreifen und integrieren, um Wege aus dem Trauma aufzeigen
zu können. Dies soll im Folgenden am Beispiel von Folteropfern erläutert
werden.
Wer die Folter überlebt, kann nicht mehr heimisch
werden in dieser Welt
Entgegen der landläufigen
Meinung besteht das Ziel von Folter nicht darin, Geständnisse im
Verhör zu erpressen, sondern die Persönlichkeit des gefolterten
Menschen zu zerstören. Folter arbeitet mit wissenschaftlichen Methoden
und zielt darauf ab, Menschen seelisch zu brechen. Amnesty international
hat dies in den vergangenen 25 Jahren in zahlreichen Veröffentlichungen
überzeugend dargelegt. (Fiechtner, Waldmann 1984; amnesty international
1984; Lipps 1984; Kaiser 1998; van der Veen-Wahabzada 2001)
„Politische Repression und Folter dienen der Absicherung von Herrschaft
und zielen neben dem Individuum auch auf die Gesellschaft ab. Durch ‚Verwissenschaftlichung‘
und ‚Professionalisierung‘ im Zusammenwirken mit modernster Überwachungstechnologie
entsteht ein Foltersystem, das das Individuum zerstört und in seine
psychischen Strukturen eingreift. Der Einsatz subtiler psychologischer
und körperlicher Foltermethoden und die daraus resultierende Regression
machen es dem Gefolterten zunehmend unmöglich, die Zerstörung
als von außen kommend wahrzunehmen. Die externe Realität zwingt
sich in die Psyche des Opfers und beschädigt bzw. zerstört dessen
psychische Strukturen, was zur Aufrechterhaltung des repressiven politischen
Systems dient.“ (Möller, Regner 1999)
Wer die Folter überlebt, wird zeitlebens in der Erinnerung auf das
Erlebte zurückgeworfen. Die Folgen der Gewalt wirken weit über
die Haft hinaus und beeinträchtigen oft das gesamte weitere Leben.
Die Erfahrung von Gewalt und Ohnmacht hinterlässt im Überleben
der Opfer Störungen sehr unterschiedlichen Ausmaßes und unterschiedlicher
Ausprägung. Psychische Traumatisierungen haben neben psychosomatischen
Beschwerden bei den betroffenen Personen häufig schwerste Belastungsstörungen,
Persönlichkeitsstörungen, dissoziative Störungen, Anpassungsstörungen,
Beziehungsstörungen, Angstzustände, Panikattacken, psychotische
Zustände und Depressionen zur Folge, die eine selbständige Bewältigung
des Alltags unmöglich machen. Die diagnostisch unter PTSD zusammengefassten
posttraumatischen Belastungsstörungen stellen nur einen möglichen
Ausschnitt der zahlreichen möglichen Folgen von Traumatisierung dar.
Dies gilt in anderer, aber ähnlicher Weise auch für Traumatisierungen
aufgrund von Krieg oder sexualisierter Misshandlung.
Psychosoziales Trauma – also Trauma, das aufgrund von politischen und
sozialen Verhältnissen, von Krieg, Unterdrückung und speziell
Folter zustande kommt – ist damit etwas ganz anderes als ein Trauma aufgrund
eines Unfalls oder einer Naturkatastrophe. Bei einem psychosozialen Trauma
handelt es sich um „man made desaster“. Es bezieht sich immer
auf die Individuen und die gesamte Gesellschaft, es hat Prozesscharakter,
bleibt also nicht auf ein Einzelereignis beschränkt, und ist immer
nur in Bezug auf einen spezifischen soziokulturellen Kontext zu verstehen.
(Möller, Regner 1999; Friedrich 1999; Preitler 1999)
Das Trauma als Prozess
Verlässt eine Person ihre
Heimat nicht freiwillig, so wirken die entstandenen Brüche und Verluste,
Enttäuschungen und Traumata umso schmerzlicher. Die Flucht ist sowohl
ein geografischer Wechsel und Bewegung, als auch und vor allem ein innerseelischer
Bruch mit bisher Bekanntem. Dieser dauert lebenslang an. In der neuen
Gesellschaft angekommen, geht der Prozess des Traumas weiter. Dieser wird
u.a. durch die Ungewissheit über den Verbleib der zurückgebliebenen
Familienmitglieder und Bekannten, durch negative Nachrichten aus der Heimat,
durch die negativen Erfahrungen in Deutschland, durch die sozialrechtliche
Lebenssituation fortgesetzt bzw. verschärft. (Aycha 2001)
Es scheint daher sinnvoll, das von Hans Keilson stammende Konzept der
„sequentiellen Traumatisierung“ zu verwenden. Dieses Konzept
erfasst den Prozesscharakter, indem es verschiedene Sequenzen unterscheidet,
z.B.: im Krieg, die Nachkriegssituation, der Friede, oder auch: Exil und
Rückkehr. Sie dienen als Rahmen, mittels dessen man den aktuellen
Stand der Traumaarbeit erfassen kann. So wird verständlich, weshalb
in der Therapie von Flüchtlingen im Exil nicht allein die Konsequenzen
des primären Traumas bearbeitet werden, nicht allein die Vergangenheit,
sondern ebenso die Gegenwart als Bestandteil des traumatischen Prozesses
Berücksichtigung findet. Teil des Traumas ist also nicht nur z.B.
die Vergewaltigung im Lager, sondern auch die Retraumatisierung durch
aktuelle Ausgrenzung, Sondergesetze für Flüchtlinge, drohende
Abschiebung, Wohnsituation, Arbeitseinschränkung etc. Auch die Symptome
chronischer Angst, wie Passivität, Gefühle von Nutzlosigkeit
und Abhängigkeit, können so besser verstanden werden. Behandlung
ist dann auch nicht mehr nur eine ausschließliche psychotherapeutische
Spezialaktivität, sondern umfasst ein breites interdisziplinäres
Spektrum. (Keilson 1979)
Therapie mit Folteropfern – eine interdisziplinäre
Aufgabe
Um der besonderen Situation
von traumatisierten Flüchtlingen gerecht zu werden, kommen verschiedene
Therapieansätze zur Anwendung. Starre Therapiemuster sind nicht geeignet.
Nur durch eine Kombination unterschiedlicher Methoden, die flexibel angewendet
werden, und eine variable Handhabung des therapeutischen Settings ist
es möglich, den Teufelskreis traumatischer Belastungen im therapeutischen
Prozess aufzubrechen.
Stets müssen jene Anteile aus dem allgemein anwendbaren Therapiespektrum
ausgewählt, kombiniert und integriert werden – von Gesprächstherapie,
über Verhaltenstherapie, psychosoziale Therapie, tiefenpsychologische
Ansätze, bis hin zu Kunst- und Musiktherapie -, die den individuellen
Umständen und Notwendigkeiten der KlientInnen entsprechen, abhängig
vom aktuellen Status ihres Traumaprozesses und abhängig vom jeweiligen
soziokulturellen Hintergrund. Bei Bedarf sollten zusätzlich Entspannungstechniken
oder konzentrative Bewegungstherapie zur Verfügung stehen.
Außer kognitiv-sprachlichen Therapiemethoden spielen in der Therapie
von Folteropfern auch nonverbale Methoden eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen
die Annäherung an das „Unaussprechliche“ und fördern
die Wiederaneignung der eigenen Biographie. Jenseits dessen, können
diese Therapieformen dazu beitragen, blockierte Energien über eine
Mobilisierung vorhandener Potentiale freizusetzen. Dieses kann einen positiven
Einfluss auf den Verarbeitungsprozess, die sogenannte Traumaarbeit, haben.
In speziellen Fällen kann auch der Einsatz von Psychopharmaka notwendig
sein, um schwere Krisensituationen zu überwinden und die Therapiefähigkeit
der KlientInnen wiederherzustellen.
Welche Strategie auch immer einer spezifischen Störung angemessen
ist, sie muss mittelfristig dazu führen, das Erlebte als Bestandteil
der eigenen Biographie zu akzeptieren, es aktiv in diese zu integrieren
und das Erlittene langfristig in Form von Trauerarbeit zu durchdringen
und seine Folgen zu überwinden.
Mehr noch als in anderen TherapeutInnen-KlientInnen-Beziehungen ist bei
der Arbeit mit Folteropfern die Schaffung eines intensiven Vertrauensverhältnisses
zwischen TherapeutInnen und KlientInnen unverzichtbar. Dies wird entscheidend
durch das Selbstverständnis der TherapeutInnen beeinflusst und erfordert
eine positive Parteinahme hinsichtlich des Verfolgungsschicksals der KlientInnen.
Zusätzlich wird der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses durch
das äußere Bild der Institution geschaffen. Hierzu zählt
neben den üblichen Faktoren auch die öffentliche Wahrnehmung
der Behandlungseinrichtung als eine parteilich im Sinne von Menschenrechtsarbeit
agierende Institution.
Der therapeutische Ansatz in der Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen
liegt darin, das gesellschaftlich bedingte, aber stets individuell erlittene
Leiden zu entprivatisieren: die traumatische Erfahrung wird aus ihrer
gesellschaftlichen Verursachung im intersubjektiven Zusammenhang verstanden.
Die Therapie verbindet daher die Rehabilitation der Einzelnen mit dem
Versuch der Rehabilitation ihrer sozialen Welt – der Gemeinde im engeren
Sinn, des zerrissenen Netzes der alltäglichen Beziehungen, aber auch
der weiteren politischen und ökonomischen Verhältnisse. Dies
setzt die Durcharbeitung des einzigartigen individuellen Schicksals im
historischen Zusammenhang voraus, der selbst erst verständlich wird,
wenn die Einzelnen die Gelegenheit erhalten, ihren Schmerz, ihre Verzweiflung,
aber auch ihre Wut und ihren legitimen Anspruch auf Vergeltung des erlittenen
Unrechts zu artikulieren.
Psychosoziale Therapie
Diese Einsicht ist eine Grundvoraussetzung,
um psychosoziale Therapieformen erfolgreich zur Anwendung bringen zu können,
denen im Rahmen der Traumatherapie eine außergewöhnliche Bedeutung
zukommt. Für das Verständnis der Rolle psychosozialer Therapie
ist es wichtig, „psychosozial“ als Methode und nicht allein
als Ziel im Sinne psychosozialer Rehabilitation zu verstehen, d.h. als
spezifische methodische Annäherung an die Lösung der vorhandenen
Probleme. Darüber hinaus ist der psychosoziale Ansatz als Verpflichtung
anzunehmen: einerseits, um das Interesse auf den einzelnen Menschen in
seiner oder ihrer subjektiven Lebensrealität lenken zu können,
d.h. Gefühle und Bedürfnisse herauszufinden und deren im Laufe
der individuellen Lebensgeschichte gewachsene Ausprägung zu verstehen;
andererseits aber auch immer das Interesse dem umgebenden soziokulturellen
Kontext zuzuwenden, d.h. stets die spezifischen ökonomischen, kulturellen,
politischen Bedingungen mit in Betracht zu ziehen. In diesem Sinne sollte
die Orientierung niemals allein psychologisch oder ausschließlich
soziokulturell sein, sondern sie muss stets beides gleichzeitig im Auge
haben.
Ferner ist „psychosoziale Therapie“ als die Notwendigkeit zu
verstehen, prozessorientiert zu arbeiten, sowohl in Bezug auf die Einzelperson,
als auch in sozialer Hinsicht. Und „psychosozial“ ist niemals
im Sinne einer Defizittheorie zu verstehen, sondern setzt voraus, nach
den vorhandenen Potentialen zu fragen und diese zu stärken.
Um einen nachhaltigen Therapieerfolg zu erreichen, verfolgt psychosoziale
Therapie auch das Ziel, Perspektiven und Strategien für die soziale
und berufliche Rehabilitation und Wiedereingliederung zusammen mit den
KlientInnen und ihren sozialen Netzwerken zu entwickeln, ihnen Schritt
für Schritt zu ermöglichen, die Kontrolle über den Alltag
zurückzugewinnen und schließlich ihr Leben wieder selbst in
die Hand nehmen zu können.
Diese Ziele psychosozialer Therapie müssen durch entsprechend ausgebildetes
und erfahrenes Fachpersonal wie SozialarbeiterInnen oder SozialpädagogInnen
durchgeführt werden, um retraumatisierende Faktoren im Alltag frühzeitig
zu erkennen, diesen Entwicklungen soweit möglich entgegenwirken und
auf diese Art eine erfolgreiche psychologische und soziale Rehabilitation
sicherstellen zu können. Aus diesem Grund gehört es zur psychosozialen
Therapie traumatisierter Flüchtlinge, einen sicheren Aufenthaltsstatus
durchzusetzen, da nur in einer dauerhaft sicheren Umgebung eine langfristige
Option zur Genesung wirklich besteht.
Auch die Herstellung von Kontakten zu in Deutschland lebenden MigrantInnengruppen
aus dem Herkunftsland, einschließlich der Bereitstellung eines Angebots
spezifischer soziokultureller Aktivitäten, kann eine maßgebliche
Rolle spielen, wenn sie den KlientInnen bei der Überwindung einer
möglichen sozialen Isolation hilft.
Zur Entlastung des alltäglichen Lebens, das zahlreiche Konfliktpunkte
mit vielen den Flüchtlingen selbst unbekannten bürokratischen
Prozessen und Behörden beinhaltet, kann es notwendig sein, die KlientInnen
bei Besuchen von Verwaltungseinrichtungen, wie Ausländeramt, Arbeitsamt,
Sozial-, Gesundheits- und Wohnungsamt, zu begleiten. Auch gehört
es zu den Arbeitsaufgaben, die sozialarbeiterisch Geschulten im Rahmen
der psychosozialen Therapie zukommen, Konflikte zu klären und Nachteile
zu beseitigen, die sich aus strukturellem Rassismus gegenüber Flüchtlingen
ebenso ergeben können, wie aus bestimmten Verhaltensauffälligkeiten
der Traumatisierten selbst, die aus einer mehr oder minder starken Persönlichkeitsstörung
resultieren können. Klärende Diskussionen mit RechtsanwältInnen,
VermieterInnen, TeammitarbeiterInnen, ArbeitgeberInnen und anderen, denen
unter Umständen eine spezielle Geduld und Rücksichtnahme während
der Dauer der Therapie abverlangt werden muss, können notwendig sein
und müssen von kompetenten SozialarbeiterInnen übernommen werden.
Bereitstellung gleichgeschlechtlicher TherapeutInnen
Da Folter das Ziel verfolgt,
die menschliche Würde zu zerstören, gehört die Ausübung
von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung zu den regulär und systematisch
gegen Frauen wie Männer ausgeübten Foltermethoden. Aufgrund
gesellschaftlicher Tabus zählt erlittene sexualisierte Gewalt zu
den von Seiten der Opfer am schwersten auszusprechenden Verletzungen.
Folglich ist die Bereitstellung gleichgeschlechtlicher TherapeutInnen
eine essentielle Voraussetzung, damit die KlientInnen eine Chance erhalten,
sich in der Therapie auch in diesem sensiblen Bereich zu öffnen und
die damit verbundene spezifische Scham und die empfundene Schande überwinden
zu können.
Interkulturelle Therapieansätze
Doch nicht nur dieser Ansatz
unterscheidet die Therapie mit Opfern von Folter, Krieg oder Vergewaltigung
erheblich von der Therapie mit aus anderen Gründen traumatisierten
KlientInnen. Auch die Herkunft von Flüchtlingen muss bei der Auswahl
der Therapiemethoden spezielle Berücksichtigung finden.
Ein interkultureller Therapieansatz erschöpft sich nicht alleine
in der notwendigen sprachlichen Kompetenz der TherapeutInnen. Auch eine
Vertrautheit mit kulturellen Gewohnheiten sowie den sozialen und politischen
Verhältnissen im Herkunftsland ist erforderlich. So erreichen z.B.
zahlreiche Flüchtlinge die Bundesrepublik, die aus Ländern stammen,
in denen der kulturelle Umgang mit psychischen Schwierigkeiten oder Erkrankungen
nicht in Form einer Individualtherapie geregelt ist. In diesem Verständnis
soll in der Regel nicht die Person an ihre Umwelt angepasst werden, sondern
das erschütterte Verhältnis zwischen Individuum und sozialer
Umwelt wird rituell, mittels Symboliken, wiederhergestellt. Hierzu gehört
die Wiederherstellung der verlorenen Ehre (z.B. durch Rache) ebenso, wie
religiöse Kulthandlungen. Individuelle Psychotherapie als Methode
der Heilung ist jedoch in zahlreichen Kulturen weitgehend unbekannt. Nur
mit einem hohen Maß an interkultureller Kompetenz kann es daher
gelingen, einen entsprechenden therapeutischen Zugang aufzubauen. (Preitler
1999)
Traumatherapie mit Flüchtlingen – eine Aufgabe
für Spezialeinrichtungen
Die Maßnahmen einer Therapie
mit Opfern und Überlebenden von schweren Traumatisierungen müssen
daher speziell auf diese Personengruppe zugeschnitten sein. Um dieses
Ziel zu erreichen, ist ein therapeutisches Konzept erforderlich, das folgenden
Punkten Rechnung trägt:
- Art und Geschichte des
Traumas - persönlicher, politischer,
kultureller und sprachlicher Hintergrund des Opfers - Biographie im Herkunftsland
- Biographie im Exil, in Deutschland
- Beziehungsgefüge zwischen
Individuum und sozialen Netzwerken (familiäre Situation, Bekanntenkreis) - ökonomische und berufliche
Situation des Opfers
Einrichtungen, die über
das nötige Spezialwissen, die unerlässliche interkulturelle
Kompetenz und die erforderliche Erfahrung im Umgang mit traumatisierten
Flüchtlingen verfügen, sind im gesamten Bundesgebiet Mangelware
und können nicht durch das bestehende Gesundheitssystem ersetzt werden.
In NRW existieren nur drei Zentren (in Köln, Much und Düsseldorf),
die in unterschiedlichem Ausmaß Hilfe für Folteropfer anbieten
können, sowie einzelne TherapeutInnen, die sich – wie innerhalb der
Medizinischen Flüchtlingshilfe – auf die Therapie von Folteropfern
spezialisiert haben. All diese Zentren, in NRW und darüber hinaus,
sind hoffnungslos überlaufen und weisen lange Wartelisten auf. Allein
die Warteliste der Medizinischen Flüchtlingshilfe umfasst derzeit
ca. 45 Personen, ohne dass die Therapiemöglichkeit bisher öffentlich
angekündigt wurde.
Internationalen Statistiken zufolge finden sich unter den in Deutschland
Schutz und Asyl suchenden Flüchtlingen und Asylbewerbern zwischen
5 und 30% Überlebende von Folter, insbesondere von sexualisierter
Folter, Misshandlung, Verfolgung, Vertreibung und zum Teil schwerwiegender
Traumatisierung aus Kriegs- und Krisengebieten. Vor diesem Hintergrund
entspricht die Anzahl der zur Verfügung stehenden ExpertInnen nicht
annähernd dem notwendigen Bedarf.
Um dieses Defizit im Ruhrgebiet zu beheben, soll die in Bochum bestehende
Einrichtung der Medizinischen Flüchtlingshilfe bedarfsgerecht ausgebaut
werden.
Literatur:
amnesty international 1984:
Gegen Folter – Ein Bericht zur Kampagne gegen die Folter
Aycha, A. 2001: Behandlungsmöglichkeiten traumatisierter Flüchtlinge,
in: Asylpraxis, Schriftenreihe des Bundesamtes für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge, Band 7
Becker, D. 1997: Prüfstempel PTSD – Einwände gegen das
herrschende ‚Trauma‘-Konzept, in: medico international Schnelle Eingreiftruppe
Seele
Fiechtner, U., Waldmann, U. 1984: Am Rande – Fragmente über
die Folter, Schriften für amnesty international 7
Friedrich, V. 1999: Die Überwältigung der Sinne durch
das Foltertrauma, in: B. Möller et al.: Politische Traumatisierung:
Verfolgung, Erzwungene Migration und Möglichkeiten therapeutischer
Hilfe, in: Zeitschrift für politische Psychologie, Jg. 7, Nr. 1+2
Kaiser, G. 1998: Folter und Mißhandlungen in Europa, in:
G. Köhne: Die Zukunft der Menschenrechte – 50 Jahre UN-Erklärung:
Bilanz eines Aufbruchs
Keilson, H. 1979: Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Deskriptiv-klinische
und quantifizierend-statistische follow-up Untersuchung zum Schicksal
der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden
Küchenhoff, J. 2000: Trauma Gewalt und kollektives Gedächtnis,
Psyche-Sonderheft 9/10
Lipps, E. 1984: Psychologie der Folter, in: amnesty international
Campaign Against Torture, CAT-Infopaket II 12.1
Merk, U. 2000: Psychosoziale Arbeit nach Krieg und Diktatur. Tagungsunterlagen
21.06.2000, medico international
Möller, B., Regner, F. 1999: Die Verschränkung von äußerer
und innerer Realität bei politischer Verfolgung und Folter, in: Zeitschrift
für politische Psychologie, Jg. 7, Nr. 1+2
Preitler, B. 1999: Psychotherapie mit Folterüberlebenden im
europäischen Exil, in: B. Möller et al.: Politische Traumatisierung:
Verfolgung, Erzwungene Migration und Möglichkeiten therapeutischer
Hilfe, in: Zeitschrift für politische Psychologie, Jg. 7, Nr. 1+2
Seibert, T. 2000: Die Gewalt überleben, in: ak – analyse &
kritik, Nr. 441
Summerfield, D. 1997: Das Hilfsbusiness mit dem ‚Trauma‘,
in: medico international Schnelle Eingreiftruppe Seele
van der Veen-Wahabzada, A. 2001: Kampagne gegen die Folter. Aus
der Arbeit von amnesty international, in: Jahrbuch Menschenrechte 2001